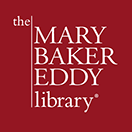Adrienne Vinciguerras Zeugnis in Ein Jahrhundert christlich-wissenschaftlichen Heilens

Bild von einem der Wachtürme, von dem aus die Soldaten den Stacheldrahtzaun um das Lager überblickten. Sie waren mit Suchscheinwerfern und Maschinengewehren ausgestattet, um eine Flucht aus dem Stalag zu verhindern. Circa 1942. Mit freundlicher Genehmigung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, DÖW.
Im Jahr 1966, 100 Jahre nach Mary Baker Eddys Entdeckung der Christlichen Wissenschaft, gab die Verlagsgesellschaft der Christlichen Wissenschaft Ein Jahrhundert christlich-wissenschaftlichen Heilens heraus. Das Buch – eine Sammlung von Berichten über Heilungen, die sich im Laufe der Jahrzehnte ereignet haben – enthielt ein bisher unveröffentlichtes Zeugnis von Adrienne Vinciguerra (1918–1995). Es beschrieb ihre Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg.1
Vinciguerra erklärte, dass sie, nachdem sie von der Christlichen Wissenschaft erfahren hatte, zu Fuß ein Kriegsgefangenenlager der Nazis verließ und quer durch das Dritte Reich reiste, um die Religion kennen zu lernen. Die Mary Baker Eddy Bibliothek wird manchmal gefragt, ob ihr Bericht wahr sei. Und auch, ob Ein Jahrhundert christlich-wissenschaftlichen Heilens nicht mehr aufgelegt wurde, weil ihr Zeugnis nicht glaubwürdig war.
Nachdem wir dies in unseren Aufzeichnungen und anderen verfügbaren Quellen nachgeprüft haben, können wir nachvollziehen, warum solche Fragen im Laufe der Jahrzehnte aufgekommen waren. Durch die neuen Informationen, die jetzt ans Licht kommen, wird man einiges vielleicht besser verstehen. Folgendes haben wir bisher herausgefunden.
Lily Adrienne Vinciguerra wurde am 9. Februar 1918 in Wien, Österreich, als Tochter von August Vinciguerra und Blanche Mabel Hobling geboren.2 Ihre Mutter starb, als sie neun Jahre alt war. Im Jahr 1939, ein Jahr nachdem Österreich unter die Kontrolle der Nationalsozialisten gekommen war, heiratete sie Desider Hajas de Simonyi (1914–1970), einen ungarischen Staatsbürger. Er war auch unter dem deutschen Namen Dominik Hartmann bekannt. Nach Angaben von Vinciguerra diente er in der deutschen Armee. Nach dem Krieg ließen sie sich scheiden.3 Diese biografischen Informationen beruhen auf Berichten von Vinciguerra selbst; weitere Recherchen sind erforderlich, um sie zu bestätigen.
Ein Jahrhundert beschrieb Vinciguerras Zeugnis als „hier mit allen Einzelheiten, unredigiert, im zwanglosen Unterhaltungsstil wiedergegeben …“ Bei dem Bericht handelte es sich jedoch um eine bearbeitete Transkription einer Tonaufnahme, die Vinciguerra 1963 im Auftrag der Mutterkirche gemacht hatte. Hier ist ein Beispiel für die Unterschiede zwischen den beiden Berichten. Das veröffentlichte Zeugnis beginnt mit folgender Aussage:
Es war im Jahre 1942. Ich lebte in Österreich. Ich befand mich zu der Zeit im Stalag 17 A. Das war ein Kriegsgefangenenlager an der ungarischen Grenze. Dort waren auch junge Leute wie ich, deren Eltern, wie man wußte, in der Untergrundbewegung gearbeitet hatten.4
Andererseits sagt Vinciguerra in der Transkription der Tonbandaufnahme Folgendes:
„Ich befand mich im Stalag 17A … das für junge Leute war, deren Eltern im Untergrund arbeiteten, Leute, die keinen jüdischen Hintergrund hatten, aber sie waren unerwünscht und man konnte nicht viel mit ihnen machen, also behielten sie uns in diesem Lager …“5

Eine Gesamtansicht des Lagers mit seinen Baracken, von Norden aus gesehen, um 1946. Mit freundlicher Genehmigung der Museen und des Kulturvereins in Kaisersteinbruch, MuK.
Vinciguerra berichtete auf dem Tonband auch, dass „es andere österreichische Jugendliche [im Stalag 17A] gab, aus demselben Grund, aus dem ich dort war, aber eigentlich war es ein Kriegsgefangenenlager für Franzosen, für französische Kriegsgefangene und Russen.“ In einem Telefongespräch mit einem Mitarbeiter der Mutterkirche erläuterte sie:
… Ich war dort wegen der Arbeit meines Vaters, aber es war ein Kriegsgefangenenlager … Wir waren nur dort, um – sie konnten uns nicht in Konzentrationslager stecken, weil wir keine Juden waren – sie mussten uns einfach irgendwo hinter Stacheldraht verwahren, weil wir aus ihrer Sicht nicht besonders vertrauenswürdig waren. Und die Behandlung war grausam, aber es war kein Konzentrationslager. Das Ziel war die Inhaftierung; ich meine, niemand ist von dort weggegangen; ich war die Einzige, die jemals einfach zu Fuß diesen Ort verlassen hat. Niemand ist weggegangen. Alle anderen mussten warten, bis die Amerikaner 1945 kamen. Man konnte nicht einfach hinausgehen …6
Forscher:innen der Bibliothek erfuhren durch den Bericht von Constantin Joffé, einem ehemaligen französischen Kriegsgefangenen, mehr über Stalag 17A. In seinem 1943 erschienenen Buch We Were Free [Wir waren frei] schrieb er über seine Gefangenschaft in diesem Lager.7 Eine Rezension des Buches in der New York Times enthielt folgende Erklärung der dortigen Bedingungen:
Das Gefangenenlager, in dem Herr Joffé und 90.000 weitere Personen eingesperrt waren, befand sich in Kaisersteinbruch in Österreich, nahe der ungarischen Grenze, und war als Stalag XVII A bekannt. Die Bedingungen waren fürchterlich. Sanitäre Einrichtungen waren praktisch nicht vorhanden. Dreck, Lumpen, Kälte und Krankheit bestimmten das Leben dort. Die Verpflegung bestand aus einer Tasse Kaffee-Ersatz aus Eicheln, sechseinhalb Unzen [185 Gramm] Brot und zwei Tassen Suppe pro Tag.
Joffé beschrieb dann die Suppe:
Kartoffeln, schwarz verfault und fast flüssig, ungeschält und ungewaschen ins Wasser geworfen, mit einem Hauch von Salz, einem Hauch von Margarine, und serviert, wenn sie gar waren; das Gemurkse roch mehr nach Dreck als nach Essen; ich bin sicher, kein Straßenköter hätte diesen köstlichen Eintopf verdauen können. Als ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, konnte ich ihn nicht anrühren; der Geruch war so streng, dass ich mich übergeben musste. Später, als der Hunger unsere Wahrnehmung solcher Besonderheiten abschwächte, kämpften meine Kameraden und ich darum, ihn zu bekommen.
Der Rezensent der Times fasste mehrere Punkte in Joffés Memoiren zusammen, die für die Beurteilung von Vinciguerras Behauptungen von Bedeutung sein könnten:
Menschen erkrankten und starben. Sie schufteten in den Salzbergwerken und auf den Straßen. Einige wurden gefoltert, alle wurden ständig gedemütigt. Es kam jedoch immer wieder vor, dass einigen wenigen die Flucht gelang. Einige der österreichischen Militärwachen erwiesen sich als leidenschaftliche Nazi-Gegner mit sozialistischen oder kommunistischen Überzeugungen.8
In ihrer Tonbandaufzeichnung erinnerte sich Vinciguerra daran, dass sie im September 1942 „zwei Wochen Urlaub [erhielt], um einen Augenspezialisten in Wiesbaden zu konsultieren.“ Anlässlich dieses Besuchs gab der Arzt ihr ein Exemplar von Eddys Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift sowie eine Ausgabe des Herolds der Christlichen Wissenschaft. Auf der Rückreise zum Stalag 17A bekam sie eine Bibel.9
Die Glaubwürdigkeit ihrer Reise ohne Begleitung zwischen dem Lager und Wiesbaden – eine Entfernung von etwa 800 km – warf für B. Crandell Epps, der an der Vorbereitung von Ein Jahrhundert beteiligt war, Fragen auf.10 Während eines Telefongesprächs befragte er Vinciguerra zu dieser Reise:
Dann hatten Sie eine Art Passierschein, und die, vielleicht dachten die einfach, dass Sie ohne Ihren Ausweis oder Ihre Identitätskarte oder Lebensmittelmarken würden zurückkommen müssen. Muss man es sich so ungefähr vorstellen? Als man Ihnen erlaubte, einen Arzt aufzusuchen …
Sie antwortete:
Eigentlich nicht. Wissen Sie, in Nazi-Deutschland wurde alles so streng kontrolliert – wenn man nach Wiesbaden ging, wenn man einen Passierschein dorthin bekam, konnte man, menschlich gesehen, nichts anderes tun, als sich dorthin zu begeben. Alles wurde überwacht; alles wurde kontrolliert; jeder – es wurde immer kontrolliert, wo man sich befand …11
Vinciguerra erzählte in ihrem veröffentlichten Bericht, dass das, was sie in Wissenschaft und Gesundheit las, eine unmittelbare Wirkung hatte. Als sie aus Wiesbaden ins Lager zurückkehrte, so behauptete sie, sei „diese ausreichend gewesen, um meinen Gesichtsausdruck so sehr zu verändern, dass mich einige Leute im Lager nicht mehr erkannten.“ Sie erinnerte sich, dass sie „Tag und Nacht“ die Bibel und Wissenschaft und Gesundheit studierte und dass das Studium all ihre Gedanken in Anspruch nahm. „Ich saß in diesem einen Raum, den wir hatten – zwölf Frauen in einem Raum – mit einer Glühbirne an der Decke“, erinnerte sie sich. „Ich saß auf dem Boden und verbrachte jede Minute, die ich irgendwie entbehren konnte, mit dem Studium.“
Nach einigen Monaten hatte sie eine Erleuchtung:
Plötzlich erhaschte ich einen Schimmer davon, was der Mensch ist: das geistige Bild und Gleichnis Gottes. Es war, als ob sich eine Nebelwand öffnete und ich sah, dass der Mensch – so wie er wirklich ist – nicht in einem Gefängnis festgehalten werden kann, er kann nicht in einem Lager eingesperrt werden, sondern er ist so unbeschränkt und unbegrenzt wie Gott. Es schien geradezu lächerlich zu glauben, dass man einen Menschen hinter Stacheldraht festhalten oder in irgendetwas einsperren konnte.
Und so verließ Vinciguerra im Januar 1943 ganz einfach zu Fuß und „bei vollem Tageslicht“ das Stalag 17A, mit nichts als ein paar persönlichen Gegenständen und ihren Büchern, wie sie berichtete. Niemand hielt sie auf.12
Nach einem zweistündigen Fußmarsch nahm sie einen Zug nach Wien. Ihr Motiv für die Flucht war, mehr über die Christliche Wissenschaft zu erfahren und Menschen zu finden, die ihre vielen Fragen beantworten konnten. Sie machte jedoch zunächst ihren Vater, August Vinciguerra, ausfindig und bat ihn um Geld. Obwohl dies nicht in dem gedruckten Zeugnis enthalten ist, gab sie in ihrer Tonaufnahme an, dass er später wegen Hochverrats hingerichtet wurde. Später korrigierte sie sich in dem Telefonat mit Epps vom 22. Juni 1965 in diesem Punkt und sagte, ihr Vater sei nicht hingerichtet worden, sondern habe Selbstmord begangen, „um der Hinrichtung zu entgehen“.13
Laut Vinciguerra war 1943 ein entscheidendes Jahr für sie. Nach einem kurzen Aufenthalt in Wien, wo sie zum ersten Mal einer anderen Christlichen Wissenschaftlerin begegnete, reiste sie nach Norden, in die Städte Breslau, Berlin, Rostock und Hamburg. Sie wohnte vorübergehend in dem verlassenen Ostseebad Warnemünde, um in der Nähe einer älteren Christlichen Wissenschaftlerin zu sein, die ihre Fragen beantwortete und „keine Angst hatte“.
Vinciguerra bezeugte, dass sie, obwohl sie keine Ausweispapiere oder Lebensmittelmarken besaß, reisen konnte und Ende 1943 nach Wien zurückkehrte. Möglicherweise wohnte sie in Wien bei Maria Band, einer anderen Christlichen Wissenschaftlerin. Zweiundzwanzig Jahre später nahm Band an der Jahresversammlung der Mutterkirche 1965 in Boston teil. Während ihres Aufenthalts befragte Epps sie zum Wahrheitsgehalt der Geschichte Vinciguerras. Band bestätigte, dass Vinciguerra – die sie zu diesem Zeitpunkt seit 22 Jahren kannte – ihr von ihrer Gefangenschaft, ihrer Einführung in die Christliche Wissenschaft und ihrer Flucht aus dem Stalag 17A sowie von anderen Details erzählt hatte.
Epps fragte Band nach der angeblichen Reise Vinciguerras nach Wiesbaden. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemals Menschen aus Konzentrationslagern herauslassen würden“, bemerkte er (offenbar war ihm der Unterschied zwischen Konzentrationslagern und Kriegsgefangenenlagern nicht klar), „aber sie sagte, sie habe diesen zweiwöchigen Passierschein gehabt, um das Lager zu verlassen … um einen Augenarzt aufzusuchen …“ Dann fragte er Band: „Erscheint es Ihnen logisch und glaubwürdig, dass sie sie gehen ließen, in Anbetracht dessen, wie diese Lager geleitet wurden?“ Band antwortete: „Ich denke schon, wenn man krank ist oder so, wissen Sie, also hat man ihr offenbar tatsächlich die Erlaubnis gegeben. Es gab dort keine Ärzte, ich meine keine Spezialisten. Das Lager war ziemlich primitiv, müssen Sie wissen. Also ist sie gegangen …“ Epps fragte: „Aber es war doch ungewöhnlich, dass sie einfach so zu Fuß aus dem Lager gehen konnte, oder?“ Band antwortete: „Es war sehr ungewöhnlich.“
Band erklärte Epps auch, dass sie und Vinciguerra kurz nach dem Krieg nach London gegangen waren, um bei Oberst Robert Ellis Key, CSB, Elementarunterricht in der Christlichen Wissenschaft zu nehmen. Nach dem Klassenunterricht lebte Vinciguerra mehrere Jahre in London.14
Zu dem Zeitpunkt, als sie mit Epps sprach, unterzeichnete Band eine Erklärung, in der sie sich für die Behauptungen Vinciguerras verbürgte und erklärte, dass sie persönliche Kenntnis von diesen Erfahrungen habe und bestätigte, „dass die Einzelheiten, wie angegeben, korrekt sind.“15
Bevor Vinciguerras Zeugnis in Ein Jahrhundert veröffentlicht werden konnte, musste es von Personen überprüft werden, die entweder von Vinciguerras Erfahrungen wussten oder für ihre Integrität bürgen konnten. Neben Band wurden also zwei weitere Personen kontaktiert. Naomi Price war eine Praktikerin der Christlichen Wissenschaft, die Vinciguerra 1947 kennengelernt hatte, etwa zu der Zeit, als sie Neunter Kirche Christi, Wissenschaftler, London beitrat. 1965 schrieb Price folgendes:
Ich möchte klarstellen, dass ich persönlich nicht für die Fakten in dem Bericht über Fr. Vinciguerras Erfahrungen, bevor sie nach England kam, bürgen kann. Es gibt darin natürlich verschiedene Vorfälle, von denen sie mir erzählt hat, aber ich habe sie nie dazu befragt oder sie ermutigt, darüber zu sprechen. Als der Krieg zu Ende ging, gab es kaum einen Europäer, der nicht außergewöhnliche, gefährliche und psychisch belastende Erfahrungen gemacht hatte. Als Christliche Wissenschaftler:innen befassten wir uns mit der Heilung geistiger und körperlicher Wunden. Um dies effektiv tun zu können, lernte man, die Gedanken von der Betrachtung der Kriegsumstände wegzulenken. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ein großer Teil der Geschichte von Fr. Vinciguerra für mich neu ist.
Price bestätigte, dass Vinciguerra ihr erzählt hatte, dass sie zum Augenarzt nach Wiesbaden gereist war und von ihm Wissenschaft und Gesundheit erhalten habe. Sie erinnerte sich auch, erzählt bekommen zu haben, „wie sie das Kriegsgefangenenlager verließ“ und welche Erfahrungen darauf folgten. Price fügte hinzu: „Frau Vinciguerra ist ein ungewöhnlicher, intelligenter und dynamischer Mensch und hat viele Erfahrungen gemacht, die aus dem Rahmen fallen.“16
Die Praktikerin der Christlichen Wissenschaft Helen Beamish war eine neuere Bekanntschaft von Vinciguerra, die ab 1965 in Kalifornien lebte. Zur Bestätigung des in Ein Jahrhundert veröffentlichten Zeugnisses schrieb sie, dass sie Vinciguerra seit acht Jahren kenne und zum ersten Mal von ihren Erlebnissen „vor ein paar Jahren gehört habe, und es wurde fast Wort für Wort so erzählt, wie es Ihnen geschrieben wurde“. Sie fügte hinzu, dass sie „lange Zeit nicht darüber sprechen konnte – so heilig war es ihr. Ich glaube, ich war eine der Ersten, die hier drüben davon erfahren hat. Ich denke, dass sie äußerst fähig und auch wachsam ist, um ihre wunderbare Demonstration zu schützen.“17
Vinciguerras Bericht zu bestätigen war zweifellos eine Herausforderung. Sie gab zwar die Namen von drei Personen an, die sie kannten und für ihre Integrität bürgen konnten, von denen aber keiner Augenzeuge der meisten Vorfälle gewesen war, die sie schilderte. Nur Maria Band hatte sie in Wien während der turbulenten Zeit, um die es in ihrem Zeugnis geht, gekannt.
Vinciguerra war bis 1950 in London geblieben und reiste dann nach San Francisco, um sich bei der Christian Science Benevolent Association an der Pazifikküste zur Pflegerin in der Christlichen Wissenschaft ausbilden zu lassen. Sie blieb dort 11 Monate, beendete aber den Lehrgang nicht.18 Sie blieb in den Vereinigten Staaten und wurde 1957 amerikanische Staatsbürgerin.
Im Jahr 1953 nahm Vinciguerra an der Jahresversammlung in Boston teil. Dort gab sie bei einem Mittwochabendgottesdienst in der Mutterkirche ein Zeugnis über ihre Kriegserlebnisse ab. DeWitt John, der damalige Leiter der Abteilung & Radionachrichten des Komitees für Veröffentlichungen, sprach sie darauf an, ob sie ihren Bericht aufnehmen wolle, vielleicht für die Nutzung in der kurz vor dem Start stehenden Radiosendung der Kirche How Christian Science Heals [Wie die Christliche Wissenschaft heilt]. Clayton Bion Craig, ein Mitglied des Vorstands der Christlichen Wissenschaft, sprach ebenfalls mit ihr über ihr Zeugnis und empfand es als „ganz wunderbar“19
Aber es dauerte noch zehn weitere Jahre, bis Vinciguerra 1963 die Tonaufnahme vorlegte, die die Grundlage für ihren Beitrag in Ein Jahrhundert wurde. Ihr Begleitschreiben enthält die Aussage, dass im Jahr 1953, als sie gebeten wurde, ihre Erlebnisse aufzuzeichnen, „ich am nächsten Morgen Boston verlassen wollte und mich nicht wirklich bereit fühlte, öffentlich darüber zu sprechen – jetzt tue ich es“.20
Adrienne Vinciguerras Zeugnis blieb in Ein Jahrhundert christlich-wissenschaftlichen Heilens bis das Buch vergriffen war. Es ist immer noch in vielen Leseräumen der Christlichen Wissenschaft erhältlich. Viele Fragen zu diesem faszinierenden Bericht und seinem historischen Kontext bleiben offen. Die Bibliothek wird Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr erfahren.
Lesen Sie nachfolgend eine Transkription von Adrienne Vinciguerras 1963 auf Tonband aufgenommenem Bericht, der als Grundlage für ihr Zeugnis in Ein Jahrhundert christlich-wissenschaftlichen Heilens, diente (PDF).
Lesen Sie B. Crandell Epps‘ Notizen zu seinem Telefongespräch mit Vinciguerra aus dem Jahr 1965 (PDF).
Dieser Blog steht auf unseren englischen, französischen, portugiesischen und spanischen Websites zur Verfügung.
- Ein Jahrhundert christlich-wissenschaftlichen Heilens (Boston: Christian Science Publishing Society, 1969), 137–147.
- „Lily Mabel Vinciguerra“ im US-Sozialversicherung Anmeldungs- und Anspruchs-Verzeichnis, 1936–2007, https://www. ancestry.com/discoveryui-content/view/21242070:60901?tid=&pid=&queryId=5cf85acc45ad5aeaaf5e3eb37c59d3e4&_phsrc=TUO1&_phstart=successSource, abgerufen am 12. Februar 2021. Vinciguerra änderte im Laufe der Jahrzehnte mehrmals ihren Vornamen, aber nicht ihren Nachnamen.
- Hartmann wurde später ein bekannter Musikkritiker in Wien. Siehe Sabine Nebenführ, Bakk., „Parteimedien in Krisenzeiten. Eine kritische Diskursanalyse der ‘Arbeiter-Zeitung’, ‘Das kleine Volksblatt’ und ‘Österreichische Volksstimme’ während des Ungarischen Volksaufstandes 1956 und Prager Frühling 1968.“ März 2010, Dissertation, 167.
- Ein Jahrhundert, 138.
- Transkription des Tonbandes von Vinciguerra vom November 1963, 1, Box 36743, Ordner 66013. Das Stalag 17A befand sich in der Nähe von Kaisersteinbruch, etwa 50 km von Wien entfernt.
- „Telephone Conversation Crandell Epps and Mrs. L. Adrienne Vinciguerra, June 22, 1965“ [Telefongespräch Crandell Epps und Fr. L. Adrienne Vinciguerra, 22. Juni 1965], 6–7, Box 36743, Ordner 66013.
- Constantin Joffé, übers. Jacques Le Clerq, We Were Free [Wir Waren Frei] (New York: Smith & Durrell, Inc., 1943).
- Orville Prescott, „Books of the Times“ [Bücher der Zeiten], The New York Times, 31. Mai 1943, 15. Prescott zitiert aus Joffé, We Were Free, 72–73.
- Ein Jahrhundert, 138–139.
- Epps arbeitete in dem Büro, das die christlich-wissenschaftlichen Militärseelsorger beaufsichtigte, wurde aber offenbar vom Komitee für Veröffentlichungen – dem Büro für Öffentlichkeitsarbeit der christlich-wissenschaftlichen Kirche – für die Zusammenarbeit mit Vinciguerra eingeteilt.
- „Telephone Conversation Crandell Epps and Mrs. L. Adrienne Vinciguerra, June 22, 1965“, 7.
- Ein Jahrhundert, 139.
- Transkription des Vinciguerra-Tonbands vom November 1963, 4, Box 36743, Ordner 66013; „Telephone Conversation Crandell Epps and Mrs. L. Adrienne Vinciguerra, June 22, 1965“, 7–8.
- “Verification of Mrs. L. Adrienne Vinciguerra’s testimony: Crandell Epps and Miss Maria Band, June 11, 1965” [Verifizierung von Fr. L. Adrienne Vinciguerras Zeugnis: Crandell Epps und Frl. Maria Band, 11. Juni 1965], Box 36743, Ordner 66013; Als Vinciguerra 1947 der Mutterkirche beitrat, gab sie ihren Namen als Fr. Lily Vinciguerra und ihre Adresse als 12 Randolph Ave. in London W9, England an. Ihr Antrag wurde von Marjorie L. Gilmour, CS, bestätigt und von Evelyn F. Heywood, CSB, gegengezeichnet.
- Maria Band, „Verification: Testimony of Healing Submitted by Mrs. L. Adrienne Vinciguerra, June 11, 1965” [Verifizierung: Heilungsbericht, eingereicht von Fr. L. Adrienne Vinciguerra, 11. Juni 1965], Box 36743, Ordner 66013.
- Naomi Price an David Sleeper, Brief, 23. Juli 1965, Box 36743, Ordner 66013.
- Helen Beamish an David Sleeper, Brief, 2, 23. Juli 1965, Box 36743, Ordner 66013.
- William H. Waite an David E. Sleeper, Memo, 4. August 1965, Box 36743, Ordner 66013.
- Vinciguerra berichtete über die Begegnung im Jahr 1953 in ihrem Brief an DeWitt John, 29. November 1963, Box 36743, Ordner 66013. Sie erwähnte Craig im „Telephone Conversation Crandell Epps and Mrs. L. Adrienne Vinciguerra, June 22, 1965“, 10.
- Vinciguerra an DeWitt John, 29. November 1963. Die Tonbandaufnahme ist nicht mehr vorhanden; möglicherweise wurde sie an Vinciguerra zurückgegeben.